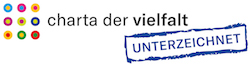Unsere Forschung
Antimikrobielle Resistenz (AMR)
Antimikrobielle Resistenz (AMR) gehört zu den größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Trotz wachsender Bemühungen, dieses Problem anzugehen, fördert der weltweite übermäßige Einsatz von Antibiotika die Entwicklung von AMR. Erkenntnisse aus psychologischen Studien helfen dabei, problematisches Nutzungs- und Verschreibungsverhalten zu verstehen und möglicherweise zu verändern, jedoch fehlen bislang Messinstrumente zur Erfassung entsprechender Konstrukte, die psychometrischen Qualitätsstandards entsprechen. Mit diesem Projekt wollen wir diese Informationslücke schließen, indem wir psychologische Messinstrumente entwickeln, um AMR-bezogenes Wissen, Einstellungen und Entscheidungsverhalten zu erfassen, die die psychometrischen Einschränkungen früherer Instrumente überwinden.
Die neuen Messinstrumente ermöglichen die Erfassung individueller Faktoren in Zusammenhang mit AMR, werden als Open-Source-Material veröffentlicht und können in einer Vielzahl von Kontexten sowohl in Forschung als auch Praxis weltweit eingesetzt werden. Darüber hinaus werden wir, sobald die neuen Messinstrumente verfügbar sind, diese nutzen, um Ursachen und Auswirkungen des übermäßigen Antibiotikaeinsatzes zu untersuchen und Interventionen zur Bekämpfung dieses Problems zu testen – sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden.
Laufzeit: 04/2022 – 2025
Team: Dr. Mattis Geiger, Dr. Lars Korn, Hellen Temme
In Zusammenarbeit mit: Prof. Dr. Robert Böhm (Universität Wien), Prof. Dr. Oliver Wilhelm (Universität Ulm) und Dr. Denise Dekker (Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin).
Verhaltenswissenschaftliche Einblicke für den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika: Ein interdisziplinäres Pilotprojekt in Ghana (BIAS)
Antimikrobielle Resistenz (AMR) stellt eine ernsthafte Bedrohung für die globale Gesundheit dar. Die Belastung ist insbesondere im Globalen Süden besonders hoch. Zu den Hauptursachen zählen der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika, Selbstmedikation, der Verkauf ohne vorherige Diagnose („Over-the-Counter“) sowie der Einsatz von Antibiotika in der Viehzucht. Diese Verhaltensweisen beschleunigen die Resistenzentwicklung und verdeutlichen, dass AMR sowohl ein medizinisches als auch ein verhaltensbezogenes Problem ist.
Trotz Fortschritten in der klinischen Forschung mangelt es an psychologisch fundierten und kulturell angepassten Instrumenten zur Erfassung von Wissen, Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit AMR. Das Verständnis der psychologischen Prozesse ist jedoch entscheidend für eine wirksame Bekämpfung von AMR.
Ziel des Projekts ist es daher, ein psychologisches Erhebungsinstrument an den ghanaischen Kontext anzupassen und zu validieren – mithilfe eines Mixed-Methods-Designs, das qualitative und quantitative Forschungsmethoden kombiniert. Dieses an kulturelle Einflussfaktoren angepasste Instrument trägt dazu bei, psychologische Prozesse hinter sachgemäßem bzw. unsachgemäßem Einsatz von Antibiotika in Ghana zu untersuchen – eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung wirksamer und kultursensibler Verhaltensinterventionen.
Laufzeit: 09/2024 - 12/2024
Team: Dr. Lars Korn, Lena Rüger, Prof. Dr. Cornelia Betsch, John Amuasi
Funding: BNITM, G-WAC
Replikation psychologischer Forschung im Globalen Süden (RePSouth)
Effektive Gesundheitskommunikation ist entscheidend, um globale Gesundheitsherausforderungen wie Infektionsausbrüche zu bewältigen. Die psychologische Forschung, auf der viele dieser Kommunikationsmaßnahmen basieren, stammt jedoch überwiegend aus dem Globalen Norden. Das wirft Fragen zur Wirksamkeit und Übertragbarkeit in anderen kulturellen und regionalen Kontexten auf. Replikationsstudien sind vor diesem Hintergrund besonders wichtig – nicht zuletzt wegen der aktuellen Replikations- und Universalitätskrise in der Psychologie, bei der sich viele Erkenntnisse nicht ohne Weiteres auf andere Kulturen übertragen lassen. Insgesamt besteht ein dringender Bedarf an kulturvergleichenden Validierungen.
Dieses Projekt schließt diese Lücke, indem häufig zitierte Kommunikationsstrategien aus dem Globalen Norden – nämlich die Kommunikation von Krankheitsrisiken und das Aufklären über Impfmythen – in Lambaréné, Gabun, auf ihre Wirkung zur Erhöhung der Impfbereitschaft getestet werden.
In einer randomisiert-kontrollierten Studie wurde untersucht, wie Videobotschaften die Impfbereitschaft gegenüber Krankheiten wie COVID-19 und Malaria beeinflussen. Die Datenerhebung in Gabun ist abgeschlossen. Aktuell bereiten wir die Replikation der Studie in Deutschland vor. Dieser kulturvergleichende Ansatz soll aufzeigen, wie Kommunikationsmaßnahmen an unterschiedliche Bevölkerungen angepasst werden müssen, um die Impfbereitschaft wirksam zu fördern.
Team: Dr. Lars Korn, Paul Anthony Mboumessieyi Ngorouma, Dr. Mattis Geiger, Pamela Minsoko, Dr. Elisabeth Sievert, Gaylord Lucien Ondoumbe, Prof. Dr. Cornelia Betsch, Selidji Todagbe Agnandji
Funding: BNITM
Beobachtung von Gesundheitswahrnehmungen und -verhalten in Subsahara-Afrika (Africa Panel)
AFRICA PANEL ist ein jährlich durchgeführtes Umfrageprojekt, das sozialwissenschaftliche Daten von Personen aus der Subsahara-Region erhebt. Für die Rekrutierung der Teilnehmenden nutzt das Projekt Plattformen von Meta (Facebook und Instagram). Ziel des Projektes ist, dem Mangel an Daten zu Gesundheitswahrnehmungen, Einstellungen, Wissen und Verhalten im Globalen Süden entgegenzuwirken. Das Projekt liefert aufschlussreiche Einblicke darin, wie gesundheitsbezogene Themen lokal verstanden und erlebt werden.
Das Projekt bietet mehrere wichtige Vorteile: Es schließt eine zentrale Lücke in der globalen Gesundheits- und Sozialforschung, ermöglicht den direkten Zugang zu vielfältigen Perspektiven und erlaubt eine skalierbare sowie kosteneffiziente Datenerhebung über digitale Plattformen. Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die evidenzbasierte Entwicklung von Maßnahmen, die gezielt auf die Bedürfnisse der Gemeinschaften in Subsahara-Afrika zugeschnitten sind.
Team: Prof. Dr. Cornelia Betsch, Dr. Lars Korn, Dr. Mattis Geiger,Dr. Jan Piebe, Maximilian Guigas
Funding: BNITM
In Zusammenarbeit mit: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Gesundheitsnationalismus und seine psychologischen Implikationen (H-Nation)
Health Nationalism (“Gesundheitsnationalismus”), also die Tendenz von ressourcenstarken Ländern, in globalen Gesundheitskrisen (wie etwa bei der weltweiten Impfstoffverteilung während der COVID-19-Pandemie) die eigene Bevölkerung zu priorisieren, kann zu ungleichem Zugang zu medizinischen Innovationen führen und bestehende Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie antimikrobielle Resistenzen (AMR), verschärfen. In diesem Projekt untersuchen wir, ob diese Exklusion auf individueller Ebene negative emotionale Reaktionen und ein verringertes Gefühl globaler Solidarität hervorruft. In einer ersten präregistrierten randomisiert-kontrollierten Studie wurden Teilnehmende aus dem Globalen Norden und dem Globalen Süden Szenarien ausgesetzt, die entweder einen eingeschränkten oder einen gleichberechtigten Zugang zu neu entwickelten Antibiotika darstellten. Die Ergebnisse zeigten, dass eingeschränkter Zugang zu stärkeren negativen emotionalen Reaktionen führte, insbesondere bei Teilnehmenden aus dem Globalen Süden. Zudem zeigte sich, dass Personen aus dem Globalen Süden andere Menschen mit Zugang zu Antibiotika als weniger freundlich und vertrauenswürdig (im Englischen als psychological warmth bezeichnet) einschätzten, was auf einen Rückgang wahrgenommener Solidarität hindeutet. Diese ersten Ergebnisse deuten auf potenzielle Verhaltens- und Emotionsveränderungen infolge des Ausschlusses von neuen Technologien hin. Laufende Folgestudien sollen diese Effekte besser verstehen und untersuchen, ob gezielte Kommunikationsstrategien helfen können, negative emotionale Reaktionen in Situationen eingeschränkten Zugangs zu verringern.
Team: Dr. Lars Korn, Prof. Dr. Cornelia Betsch, Elisabeth Sievert, Robert Böhm, Rian Groß
Funding: BNITM, Universitär Erfurt
GenDiMedNet – Geschlechtersensible Gesundheitskommunikation
Im Rahmen des Forschungsnetzwerks GenDiMedNet untersucht die AG Health Communication am BNITM, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zu geschlechtersensibler Gesundheit besser vermittelt werden können. Denn viele Krankheiten zeigen sich zum Beispiel bei Frauen oder Männern unterschiedlich – und diese Unterschiede werden in digitalen Gesundheitsanwendungen bislang oft zu wenig beachtet. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld (Netzwerkbildung, Koordination und Projektmanagement), der Charité Berlin und der Universität Greifswald (Datenmanagement) durchgeführt. Unser Teilprojekt „Wissenschaftskommunikation” entwickelt Strategien, um Forschungsergebnisse zu geschlechtersensibler Medizin für Fachleute und die interessierte Öffentlichkeit verständlich und zugänglich zu machen. Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass die Kommunikation über „Gender” bei manchen Menschen auf Reaktanz stoßen kann – also auf eine ablehnende Haltung, die entsteht, wenn sich Personen in ihren Überzeugungen oder ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Unser Ziel ist es, diese Reaktanz zu vermeiden, indem wir Informationen so gestalten, dass sie Offenheit und Verständnis fördern – unabhängig von Vorwissen oder persönlichen Einstellungen. Dazu fassen wir zunächst den aktuellen Forschungsstand in einem systematischen Review zusammen und leiten daraus Empfehlungen für eine geschlechtersensible Wissenschaftskommunikation ab. Anschließend testen wir in experimentellen Studien, wie Informationen über geschlechtsspezifische Gesundheit am besten vermittelt werden können. Die Ergebnisse fließen in praxisnahe Leitfäden, Online-Materialien und Best-Practice-Beispiele ein, die über ein Web-Portal allen Interessierten zur Verfügung stehen. So trägt das Projekt dazu bei, die Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen inklusiver und gerechter zu gestalten. Vernetzungsmöglichkeiten gibt es in naher Zukunft auf LinkedIn und Instagram.
Team: Dr. Sarah Eitze, Anne Tänzer, Jule Marie Nebendahl, Julia Aichele
IMPACTS – Investigating Motivations, Practices and Unintentional Consumption of Toxic Skin-Lightening
Hautaufhellung (Skin Lightening) ist ein komplexes Public-Health- und Gesellschaftsproblem, das in vielen Ländern im globalen Süden weit verbreitet ist, besonders in Subsahara-Afrika. Die Praxis wird durch Schönheitsideale, soziale und ökonomische Erwartungen sowie unzureichende Regulierung geprägt und birgt erhebliche gesundheitliche Risiken durch schädliche Substanzen. Die bisherige Forschung konzentriert sich vor allem auf Nutzer*innen, während Angebote, Verkaufsstrukturen und unklare Kennzeichnungen kaum untersucht wurden. Das Projekt IMPACTS will diese Lücke schließen, indem es sowohl Nachfrage- als auch Angebotsseite analysiert. Ziel ist es, gesundheitliche Risiken besser zu verstehen, regulatorische Lücken aufzudecken und Ansatzpunkte für wirksame Public-Health-Maßnahmen und Kommunikationsstrategien zu entwickeln.
Das Projekt macht versteckte Risiken und unbewusste Exposition gegenüber gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen sichtbar und liefert wichtige Daten für gesundheitspolitische Maßnahmen, Aufklärung und Kampagnen. Gleichzeitig stärkt es langfristig die Umsetzung zentraler Sustainable Development Goals und trägt insgesamt zu einer sichereren Verbraucherschutzpolitik sowie zu mehr gesundheitlicher Chancengleichheit bei.
Team: Lars Korn, Gbadebo Collins Adeyanju, Lena Rüger
Funding: German Alliance for Global Health Research (GLOHRA)
Planetary Health Action Suvey (PACE)
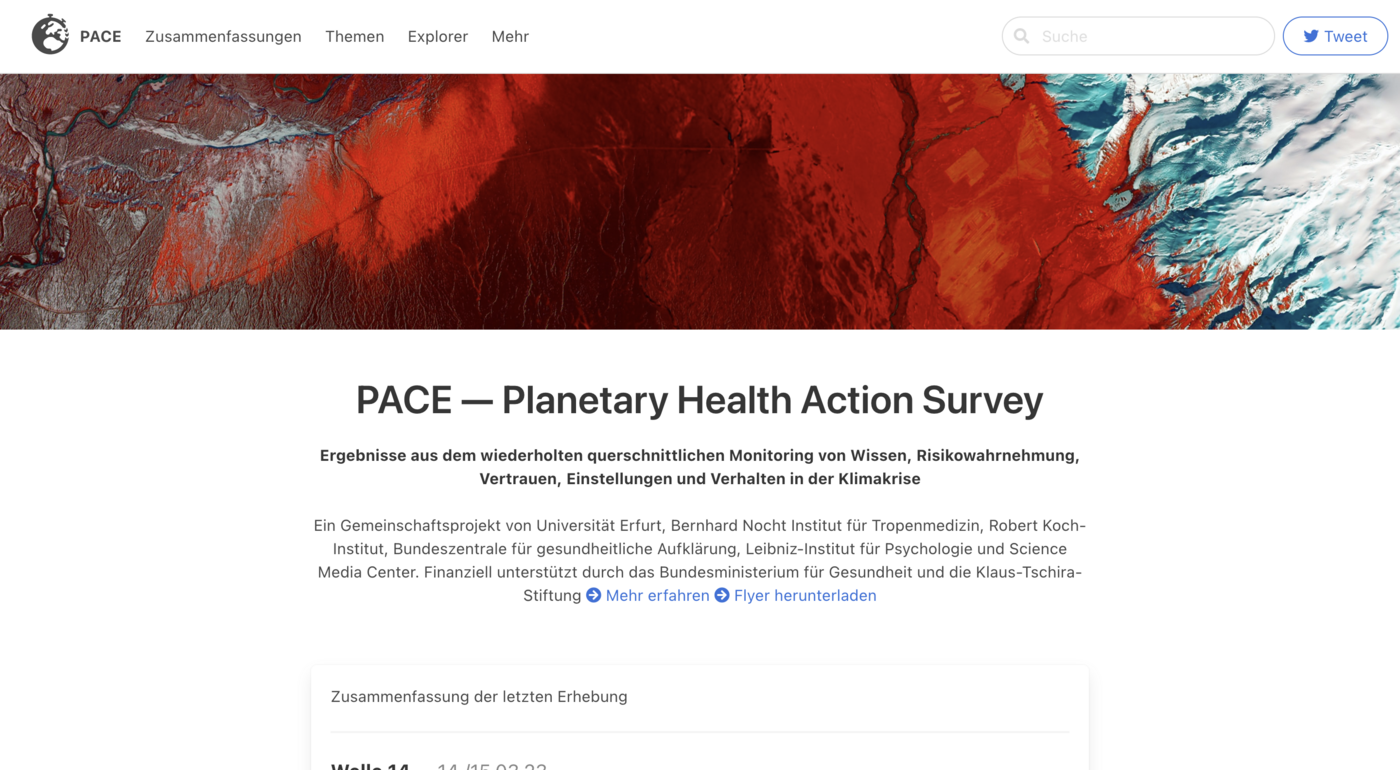

Der Klimawandel wird von Wissenschaftler*innen weltweit als die größte globale Bedrohung für die menschliche Gesundheit eingestuft. Dennoch wird bislang zu zögerlich agiert, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Das Projekt PACE (Planetary Health Action Survey) entwickelt Strategien und Methoden, um die Klimakommunikation zu verbessern und Klimaschutzmaßnahmen so zu gestalten, dass sie von der Öffentlichkeit akzeptiert und unterstützt werden. Ziel des Projekts ist es, für Klimaschutz auf politischer und gesellschaftlicher Ebene eine Grundlage zu schaffen – und ihn so zu beschleunigen.
Wiederholte Online-Befragungen tragen dazu bei, die Einflussfaktoren auf klimaschutzrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen besser zu verstehen. Die Bereitschaft, gegen den Klimawandel vorzugehen, wird dabei in Zusammenhang mit psychologischen und gesundheitsrelevanten Aspekten gebracht.
Laufzeit: 06/2022 - 12/2024; 03/2025 - 03/2028
Team: Dr. Cornelia Betsch, Prof. Dr. Philipp Sprengholz, Dr. Sarah Eitze, Dr. Mattis Geiger, Dr. Mirjam Jenny, Dr. Lars Korn, Dr. Parichehr Shamsrizi, Lena Lehrer, Hellen Temme, Lisa Marie Hempel, Kira Maur
Kontakt: pace@bnitm.de
Website: https://projekte.uni-erfurt.de/pace/
CliMed – Klima- und Gesundheitskommunikation durch medizinisches Personal
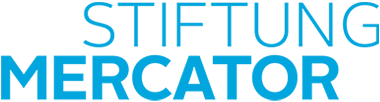
Das Projekt CliMed untersucht die Rolle von medizinischem Personal als Multiplikator*innen an der Schnittstelle zwischen Klima und Gesundheit. Es kombiniert Methoden der Gesundheitskommunikation mit Ansätzen der Verhaltensforschung und basiert auf umfassenden Bevölkerungsstudien. Im Fokus steht die Frage, inwiefern die Bevölkerung in Deutschland dem Gesundheitssektor – insbesondere medizinischem Personal – als vertrauenswürdige Kommunikator*innen für gesundheitsrelevante Themen im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen gegenübersteht. Inhaltliche Themenschwerpunkte sind unter anderem neu auftretende Infektionskrankheiten, die durch den Klimawandel begünstigt werden und gesundheitliche Auswirkungen von Hitze.
Mithilfe von Bevölkerungsstudien wird untersucht, wie akzeptiert und erwünscht Gespräche über diese Themen sind. Zudem analysiert das Projekt, ob medizinisches Personal unterschiedliche soziodemografische Zielgruppen und gesellschaftliche Milieus erreicht, wie politisch das Thema wahrgenommen wird und ob es als potenziell polarisierend gilt.
Basierend auf den Forschungsergebnissen werden praxisnahe Kommunikations- und Handlungsempfehlungen für den Gesundheitssektor, politische Entscheidungsträger*innen und relevante Institutionen entwickelt. Diese sollen zeitnah und verdichtet bereitgestellt werden, um eine effiziente Umsetzung zu ermöglichen.
Team: Dr. Parichehr Shamsrizi
Weitere Projekte
Finden Sie hier andere Projekte, die von Cornelia Betsch und ihrem Team der Universität Erfurt geleitet werden.